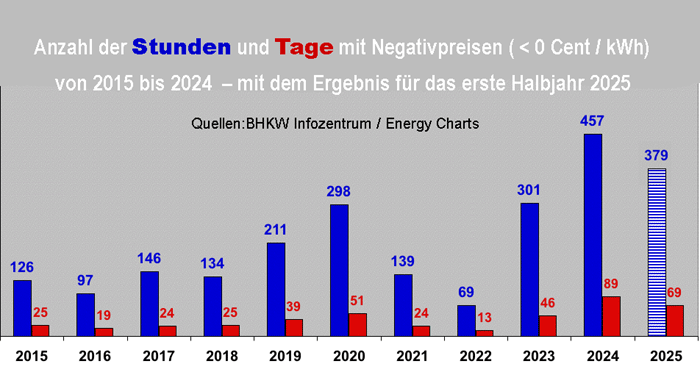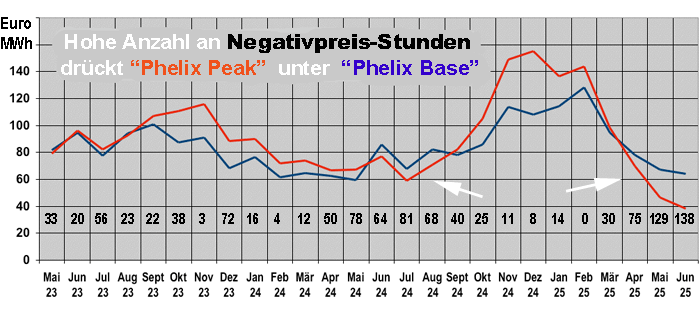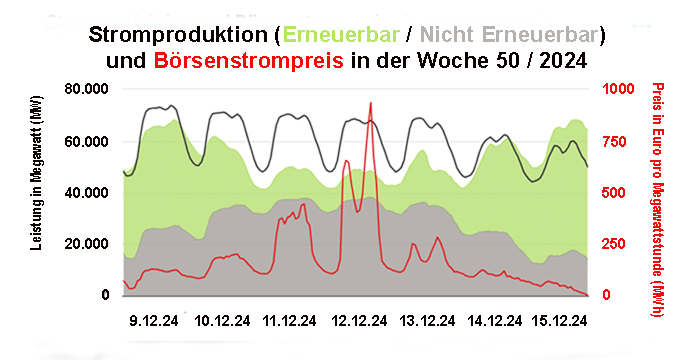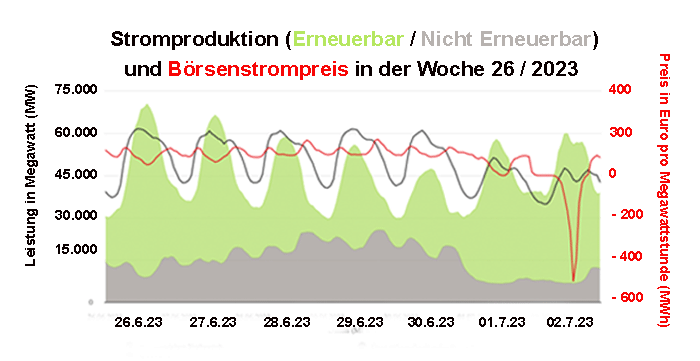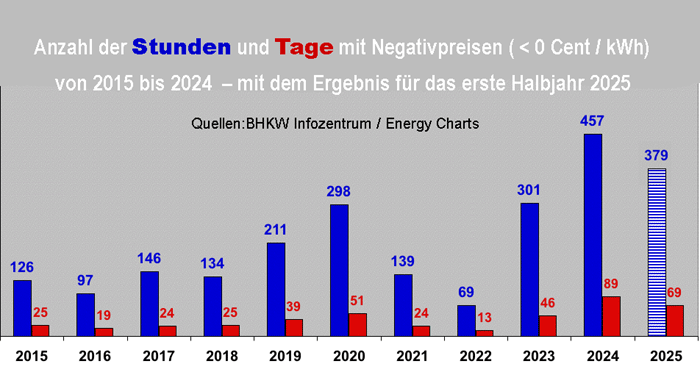 |
| Seit 2023 nimmt die Anzahl der Stunden mit Negativpreisen am Strom-Spotmarkt
wieder stark zu. Der 2024 erreichte Rekord von 457 Stunden dürfte in
diesem Jahr noch übertroffen werden, denn schon in den ersten sechs
Monaten wurde der Stand des Vorjahrs zu vier Fünfteln erreicht. |
Starker Anstieg der Stunden mit negativen Börsen-Strompreisen
Die Anzahl der Tage und Stunden mit negativen Strompreisen hat in diesem und
im vergangenen Jahr ungewöhnlich stark zugenommen. In der deutschen Stromhandelszone
war sie 2024 ungefähr viereinhalbmal so groß wie im langjährigen Mittel seit
2015. Voraussichtlich wird sie in diesem Jahr nochmals steigen. Lediglich im
Februar gab es keine Stunden mit Negativpreisen. Im gesamten ersten Halbjahr
erhöhte sich deren Anzahl jedoch gegenüber dem Vorjahr von 224 auf 379 Stunden.
Am 1. Mai stürzte der Preis im vortägigen Handel an der Epex Spot sogar bis
auf minus 120 Euro/MWh, und am darauffolgenden Sonntag (Muttertag) noch tiefer
bis auf minus 250 Euro/MWh. In der ersten Julihälfte gab es dagegen nur zwei
Tage mit insgesamt zehn Stunden, an denen der Börsenpreis schwach in den negativen
Bereich eintauchte. An zwei weiteren Tagen blieb er mit null Euro/MWh knapp
darüber.
EEG-Förderung entfällt bereits bei einer Stunde Negativpreis – dafür wird
die Vergütungsdauer verlängert
Auswirkungen hat das vor allem für die Betreiber von EEG-geförderten Stromerzeugungsanlagen:
Schon seit 1. Januar 2016 entfiel gemäß §
24 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für neue EEG-Anlagen die Förderung,
wenn die Preise an der Epex Spot an mindestens sechs aufeinanderfolgenden Stunden
negativ waren (161209). Fünf Jahre später
senkte dann das EEG 2021 in § 51 für
neue Anlagen ab 500 Kilowatt diese Schwelle auf vier aufeinanderfolgenden Stunden
(201201). Zugleich gewährte es in §
51a erstmalig eine Verlängerung der Förderung um die Gesamtzahl aller Negativpreis-Stunden,
die bis zum Ende des zwanzigjährigen Vergütungszeitraums erreicht sein würden.
Das EEG 2023 kürzte dann den vierstündigen Mindestzeitraum stufenweise auf drei
Stunden (für 2024 und 2025), zwei Stunden (für 2026) und eine Stunde (ab 2027).
Neuregelung zur "Vermeidung von temporären Überschüssen" wird auch
als "Solarspitzengesetz" bezeichnet
Durch das "Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung
von temporären Erzeugungsüberschüssen", das am 25. Februar in Kraft trat
(250112), wird seit kurzem in §
51 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) die Zahlung der EEG-Förderung
für jede Stunde gestoppt, in der die Preise am Spotmarkt negativ sind. Ersatzweise
wird den Betreibern in § 51a nach Ablauf der
zwanzigjährigen Vergütungsdauer eine Verlängerung der Vergütung gewährt, die
sich nach der Anzahl der angefallenen Stunden mit Negativpreisen richtet. Speziell
für Solaranlagen wird dabei für alle zwölf Monate des Jahres jeweils eine bestimmte
Anzahl Volllaststunden genannt, die als Berechnungsgrundlage dienen. Da es meistens
die bei hoher Sonneneinstrahlung auftretenden Solarspitzen sind, die den Preis
unter die Null-Euro-Grenze absinken lassen, wird die Neuregelung umgangssprachlich
auch als "Solarspitzengesetz" bezeichnet. Die Neufassung der §§ 51
und 51a im Erneuerbare-Energien-Gesetz gilt für Neuanlagen. Die Betreiber
von Bestandsanlagen haben aber gemäß § 100 Abs.
47 EEG die Möglichkeit, sie auch auf ihre Anlagen anwenden zu lassen.
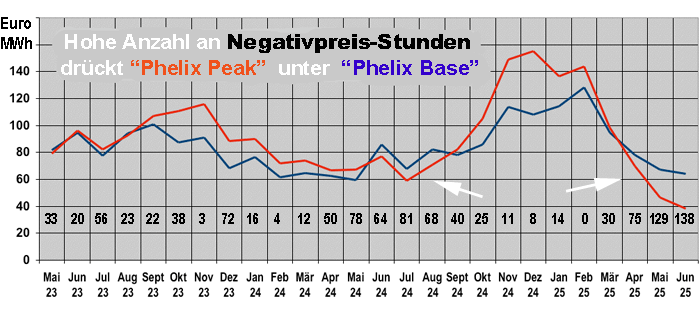 |
| Als Folge der Negativpreise ist der "Phelix Peak" (rot) zum ersten
Mal seit über zwanzig Jahren niedriger geworden als der "Phelix Base"
(blau). Und das sogar gleich zweimal drei Monate nacheinander (siehe
Pfeile). Der "Phelix" ist ein 2002 gestarteter Preisindex für den deutschen
Strom-Spotmarkt, der den stundengewichteten Durchschnittspreis pro Tag
für die Stunden 1 - 24 (base) sowie für die Stunden 9 - 20 (peak)
erfasst. Da der "Phelix Peak" die Tageszeit mit besonders hohem
Stromverbrauch und erhöhten Strompreisen widerspiegelt, ist er normalerweise
deutlich höher als der "Phelix Base". Die durchschlagende Wirkung der
Negativpreise auf den "Phelix Peak" erklärt sich daraus, dass die stark
preissenkenden Solarspitzen nur in den Stunden 9 - 20 auftreten können. |
Links (intern)
- Bei Negativpreisen entfällt der Zahlungsanspruch jetzt nach vier Stunden
(201201)
- EEG-Förderung soll schon bei einer Stunde Negativpreis entfallen (200903)
- Immer wieder sonntags: Fünf Negativpreis-Phasen hintereinander (200306)
- "Victoria" fegte den Großhandelspreis 30 Stunden lang in den Keller (200203)
- EEG-Vergütungen entfielen für 18 Stunden (200204)
- Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen hat stark zugenommen (200113)
- Konventionelle Kraftwerke produzieren auch bei negativen Börsenpreisen weiter
(191008)
- 19 Stunden lang Negativpreise für Strom am Pfingstsonntag (190606)
- Bei negativen Strompreisen ist die konventionelle Einspeisung weit höher
als technisch notwendig wäre (170404)
- Ab sechs Stunden Negativpreisen entfällt für neue Anlagen die Förderung
(161209)
- Zuviel Kohle- und Atomstrom bewirkt negative Strompreise an der Börse (140608)
- Kautelen gegen Negativpreise (140601)
- Negativpreise für Strom können weiterhin ab minus 150 Euro/kWh gestoppt
werden (130216)
- Neuregelung der EEG-Abrechnung entpuppt sich als Schildbürgerstreich (091201)
Negative Strompreise müssten nicht sein
Sie sind nur die börsenmäßige Ersatz- und Notlösung für ein Problem, das mit Wasserstoff-Kraftwerken beseitigt werden könnte
(siehe oben)
Wenn man bei Google die Frage eingibt "An welchen Warenbörsen gibt es negative
Preise?" lautet die Antwort : "Negative Preise können an verschiedenen Warenbörsen,
insbesondere im Bereich Energie, auftreten." Was dann folgt, bezieht sich aber
ausschließlich auf Strombörsen. Diese Auskunft ist wie üblich eine Zusammenfassung
einschlägiger Texte durch die "Künstliche Intelligenz", die Google neuerdings
den Antworten auf Suchanfragen voranstellt.
Die natürliche Intelligenz zieht aus dieser Auskunft den Schluss, dass negative
Preise vermutlich ein Spezifikum der Warenbörsen für Strom sind. Vorsichtshalber
fragt sie aber nach: "Gibt es an Aktienbörsen negative Preise?" Prompt kommt
die Anwort: "Ja, an Aktienbörsen können negative Preise in bestimmten Situationen
auftreten, insbesondere bei Strom." Und was dann folgt, sind die bereits bekannten
Ausführungen, die sich ausschließlich auf Strombörsen beziehen.
Es hapert also noch ein bißchen bei den Auskünften der Künstlichen Intelligenz.
Aber sonst ist es schon erstaunlich, was die elektronische Datenverarbeitung
alles zustandebringt. So hat sie inzwischen den Parketthandel an den Börsen
fast völlig verdrängt. Vor allem die Strombörsen sind nur noch als vollelektronisch
per Internet ablaufende Veranstaltungen vorstellbar. Das dürfte auch damit zu
tun haben, dass es bei dieser Variante der Börse um die einzige Ware geht, die
im selben Augenblick erzeugt und verbraucht werden muss. Schon durch die viertelstündliche
Leistungsmessung fallen da eine Unmenge Daten an, die ein Parketthandel, wie
er bei der 1998 erfolgten Liberalisierung des Energiemarktes noch üblich war,
niemals hätte bewältigen können.
Am Day-ahead-Markt der Epex Spot können Börsenteilnehmer die Ware Strom bis
jeweils zwölf Uhr am Vortag zu einem bestimmten Preis pro Megawattstunde erwerben,
wobei seit März dieses Jahres neben Stundenkontrakten auch viertelstündliche
Lieferblöcke möglich sind. Im Intraday-Handel können viertelstündliche Gebote
ab 15 Uhr des Vortags bis kurz vor dem Liefertermin am Folgetag abgegeben werden.
Die Preisbildung kommt in beiden Fällen unterschiedlich zustande: Beim Day-ahead-Handel
werden aus den eingegangenen Geboten für jede Stunde des Folgetags die sogenannten
Markträumungspreise berechnet und um 12.40 Uhr bekanntgegeben. Beim Intraday-Handel
entspricht der Preis dagegen dem jeweiligen Gebot, wenn der Handel zustande
gekommen ist ("pay-as-bid"-Verfahren).
Eine weitere Besonderheit der Strombörse ist, dass die Preisskala auch einen
Minusbereich hat. Beim Day-ahead-Handel reicht sie von 3000 Euro/MWh bis zu
minus 500 Euro/MWh. Beim Intraday-Handel können sich die Preise sogar zwischen
9.999 Euro und minus 9.999 Euro bewegen. Dieselbe technisch zulässige Spannweite
hat die Preisskala beim Terminhandel an der EEX. Dort sind negative Preise aber
vergleichsweise selten. In der Regel handelt es sich dann um Geschäfte, mit
denen versucht wird, sich gegen Schwankungen am Spotmarkt abzusichern.
Anfangs gab es auch an der Strombörse nur positive Preise
Das war nicht immer so. Beim Start der deutschen Strombörse European Energy
Exchange (EEX), die 2002 aus der Fusion von zwei Vorgänger-Börsen entstand (011008),
gab es sowohl am Spotmarkt als auch am Terminmarkt nur positive Preise, die
bei Null endeten. Das änderte sich erst mit der Zunahme des Spotmarkt-Handels
und der Erneuerbaren-Einspeisung. Es begann mit einer ein- bis zweistelligen
Anzahl von Stunden pro Jahr, in denen der Preis im vortägigen Handel bis auf
Null sank. Der Strom war in diesen Stunden also nicht nur zur Ramschware geworden,
sondern sogar zum lästigen Ballast, dessen man sich durch Verschenken zu entledigen
versuchte. Daraufhin beschloss die neu gegründete Epex Spot SE (091209),
die Preisskala ab 1. September 2008 in den negativen Bereich zu verlängern.
Prompt ergaben sich für den Rest des Jahres 15 Stunden und für das folgende
Jahr 2009 insgesamt 71 Stunden mit negativen Preisen.
Vorgänge am Spotmarkt beeinträchtigen Sicherheit der Stromversorgung
nicht
Damit wurde ein altes Problem der Netzsteuerung börsentechnisch gelöst – oder
besser gesagt: nur scheinbar gelöst – , das nun mal darin besteht, dass die
Stromerzeugung in jeder Sekunde dem Stromverbrauch ("Last") entsprechen
muss. Wenn außerhalb einer bestimmten Schwankungsbreite die Erzeugung und der
Verbrauch nicht übereinstimmen, kann das sehr schnell zum Zusammenbruch der
gesamten Stromversorgung führen, wie es soeben in Spanien und Portugal geschehen
ist (250601).
Diese Gefahr besteht indessen beim vortägigen Handel am Spotmarkt nicht,
da er den vorhersehbaren Überschuss bzw. die Knappheit am Folgetag lediglich antizipiert,
um sie in niedrigere oder höhere Preise pro Megawattstunde umzusetzen. Unabhängig
von dieser vollelektronisch ablaufenden Börsenauktion gehen die Netzbetreiber
ihrem üblichen Geschäft nach, die Stromeinspeisung mit der Lastkurve in Übereinstimmung
zu bringen. Selbst Preisexplosionen wegen Verknappung oder abgrundtiefe Negativpreise
wegen eines Überschusses an angebotenem Strom haben deshalb keine Auswirkungen
auf die Sicherheit der Stromversorgung.
Umstellung der EEG-Abrechnung begünstigte Entstehung von Negativpreisen...
Das gilt auch für die heftigen Eruptionen, die schon kurz nach der Verlängerung
der Preisskala in den negativen Bereich auftraten. Sie hatten mit einer Neuregelung
des EEG-Abrechnungsverfahrens zu tun, die von der Bundesregierung parallel zu
der Neuerung an der Strombörse – vermutlich sogar in kausalem Zusammenhang damit
– im Mai 2009 beschlossen wurde. Diese "Verordnung zur Weiterentwicklung des
bundesweiten Ausgleichsmechanismus" hat entgegen ihrer euphemistischen Bezeichnung
den bisherigen Ausgleichsmechanismus nicht weiterentwickelt, sondern abgeschafft.
Die Übertragungsnetzbetreiber wurden nun nämlich beauftragt, den gesamten EEG-Strom
am Spotmarkt zu verkaufen – besser gesagt zu verramschen. Da die bescheidenen
Erträge die Förderkosten nicht decken konnten, musste dies die EEG-Umlage in
die Höhe treiben (siehe Hintergrund, Oktober 2012).
Zugleich begünstigte das neue Verfahren die Entstehung von Negativpreisen.
...und belastete damit die Verbraucher gleich doppelt
Bis dahin waren die Förderkosten den geförderten Strommengen gleichmäßig gefolgt.
Als Folge der Neuregelung, die von den Übertragungsnetzbetreibern probeweise
schon vor dem offiziellen Inkrafttreten praktiziert wurde, stiegen sie nun prozentual
viel stärker an als die damit geförderten Mengen (siehe Grafik).
Schon am 9. Oktober 2009 ließ ein hohes Windstromaufkommen den Spotmarktpreis
bis auf die Untergrenze von minus 500 Euro pro Megawattstunde abstürzen. Zwischen
ein und sechs Uhr morgens mussten die Übertragungsnetzbetreiber und andere Anbieter
den Strom nicht nur verschenken, sondern ihm auch noch 14 Millionen Euro hinterherwerfen,
um ihn überhaupt loszuwerden (091201).
Zu ähnlichen Negativpreis-Rekorden kam es an Weihnachten 2009 (100101),
Weihnachten 2012 (130101), Weihnachten 2016 (161209),
an Pfingsten 2019 (190606) oder häufig auch an Sonntagen
(200306). Solche Kosten gingen fortan in die EEG-Umlage
ein, die bis 2022 die Verbraucher belastete. Und zwar gleich doppelt: Zum einen
durch die Förderung der EEG-Strommengen, die überflüssigerweise ins Netz eingespeist
wurden, obwohl kein Bedarf da war, und zum anderen durch die Kosten, die anschließend
ihre "Entsorgung" über Negativpreise verursachte.
|
|
Am 11. und 12. Dezember 2024 explodierte der Strompreis im vortägigen
Handel an der Epex Spot bis auf 936 Euro/MWh, weil die notwendigen konventionellen
Kraftwerkskapazitäten zum Ausgleich einer "Dunkelflaute" nicht
rechtzeitig aktiviert wurden und deshalb auf teuere Importe zurückgegriffen
werden musste.
Quelle: Energy-Charts
|
Bei "Dunkelflauten" können die Preise durch die Decke gehen...
Als jüngeres Beispiel für eine Preisexplosion im positiven Bereich der Skala
können die beiden Tage im Dezember 2024 dienen, an denen der Großhandelspreis
im vortägigen Handel bis auf 936 Euro/MWh stieg und im Intraday-Handel sogar
bis zu 1.158 Euro/MWh erreichte (241201). Der Grund
war, dass nicht genügend konventionelle Kraftwerksreserven bereit gehalten wurden,
um eine "Dunkelflaute" bei den erneuerbaren Stromquellen Wind und Sonne auszugleichen
(was normalerweise kein Problem hätte sein dürfen). Die Netzbetreiber mussten
deshalb die nicht rechtzeitig bereitgehaltene konventionelle Kraftwerksleistung
durch teuere Importe ersetzen. Die Sicherheit der Stromversorgung war aber auch
durch diese netztechnische Panne nicht gefährdet (siehe Grafik
1).
|
|
Am 2. Juli 2023 kam es zu einer Preisexplosion im negativen Bereich
der Preis-Skala, die erst bei 500 Euro/MWh gestoppt wurde. Ursache war
in diesem Fall eine "Hellbrise" mit einer so hohen Erzeugung
von Erneuerbaren-Strom, dass diese den gesamten inländischen Bedarf
überstieg. Ein Leistungsüberschuss von bis zu 12,3 Gigawatt musste deshalb
exportiert werden, was nur mit Negativpreisen gelang.
Quelle: Energy-Charts
|
...und bei "Hellbrisen" ganz tief in den Börsenkeller fallen
Da inzwischen der größte Teil des Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen gedeckt
wird – vor allem durch die fluktuierende Einspeisung von Windkraft- und Solaranlagen
– , können auch erhebliche Stromüberschüsse durch besonders viel Wind- und Sonnenenergie
entstehen. Analog zur "Dunkelflaute" wird dann von einer "Hellbrise" gesprochen.
Der Stromhandel am Spotmarkt antizipiert solche Überschüsse durch einen Preisverfall,
der nicht bei null endet, sondern mehr oder weniger weit in den negativen Bereich
führt. Dadurch wird ein sonst nicht bestehender Anreiz geschaffen, diese überschüssigen
Strommengen abzunehmen und irgendwie zu verbrauchen. Beispielsweise können so
die Betreiber von Elektrokesseln zur Absicherung der Fernwärmeversorgung, deren
Betrieb zum üblichen Strompreis unwirtschaftlich und nur in Notfällen sinnvoll
ist, den Strom sogar gratis bekommen und eine mehr oder minder große Zuzahlung
kassieren (230603). Der überschüssige Strom ist damit
kein Überschuss mehr, sondern kann tatsächlich ins Netz eingespeist werden.
Oder es finden sich Abnehmer außerhalb Deutschlands, so dass die überschüssigen
Strommengen exportiert werden können.
Als Beispiel für eine solche "Hellbrise" kann der 2. Juli 2023 dienen, als
der Preis wieder mal die ganze Börsen-Kellertreppe hinunter abstürzte, bis auf
minus 500 Euro/MWh. Der Großhandelspreis war an diesem Sonntag ganze 15 Stunden
lang negativ, weil allein schon die verfügbare Erneuerbaren-Einspeisung den
Bedarf um bis zu 17 Prozent überstieg. Die Deckung der "Residuallast" entfiel
damit (stattdessen wurde diese rechnerische Größe mit minus 1709 Megawatt negativ).
Inklusive des kleineren Anteils an konventioneller Kraftwerksleistung ergab
sich insgesamt ein Leistungsüberschuss von bis zu 12,3 Gigawatt, der die gleichzeitig
nur 42,8 Gigawatt betragenden inländische Verbrauchslast um fast 30 Prozent
überstieg (siehe Grafik 2).
Eine solche Diskrepanz zwischen Last und Einspeisung – gleichgültig ob zu
hoch oder zu niedrig – würde keine Stromversorgung auch nur eine Sekunde überleben.
Das deutsche Stromnetz ist aber kein inselartiges Gebilde, sondern eng mit den
Nachbarländern und dem kontinentaleuropäischen Stromnetz verflochten. Deshalb
war auch an diesem Tag die Stabilität der Stromversorgung nie gefährdet. Bei
den erwähnten 12,3 Gigawatt handelte es sich nämlich um Leistung, die zwar im
Inland erzeugt und an der Strombörse gehandelt wurde, dann aber über die grenzüberschreitenden
Leitungen in die Nachbarländer exportiert wurde. Das gelang allerdings nur mit
Negativpreisen.
Viele Kraftwerksbetreiber speisen trotz Negativpreisen weiter
ins Netz ein
Wenn beim vortägigen Handel an der Strombörse die Preise pro Megawattstunde
in den Sinkflug übergehen, weil der Bedarf zu gering oder das Angebot zu groß
ist, könnte man eigentlich erwarten, dass die Kraftwerksbetreiber entsprechend
reagieren. Spätestens ab Erreichen der Null-Euro-Grenze bekommen sie ja kein
Geld mehr, sondern müssen dem Käufer eine Zuzahlung leisten. Seltsamerweise
speisen aber viele Erzeuger auch dann noch Strom ein, wenn sie diesen nicht
nur verschenken, sondern sogar eine Zuzahlung leisten müssen. Das zeigte sich
bereits 2008, als die Epex Spot ihre bisherige Preisskala über null Euro hinaus
in den negativen Bereich erweiterte und damit prompt ein bislang verborgenes
Potential für Zuzahlungen sichtbar wurde.
Vorrang der Erneuerbaren-Einspeisung stand oft nur auf dem
Papier
Im Juni 2014 veröffentlichte die Initiative "Agora Energiewende" eine Studie,
die 97 Stunden mit negativen Strompreisen untersuchte, die zwischen Dezember
2012 und Dezember 2013 bei der vortägigen Auktion an der Epex Spot aufgetreten
waren. Sie gelangte zu dem Ergebnis, dass die konventionelle Stromerzeugung
nicht so zurückgefahren wurde, wie es die Erzeugung von Wind- und Solarstrom
erfordert hätte. Das im Jahr 2000 erstmals in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz
verpflichtete die Netzbetreiber nämlich zur vorrangigen Abnahme des gesamten
Stroms aus erneuerbaren Quellen und trug sogar den Titel "Gesetz für den Vorrang
Erneuerbarer Energien", bevor es 2014 in "Gesetz für den Ausbau erneuerbarer
Energien" umbenannt wurde. Die dadurch verursachten Negativpreise hätten das
EEG-Konto mit fast 90 Millionen Euro belastet, hieß es. Sie seien indessen "nicht
Ausdruck einer Überschuss-Situation von Strom aus erneuerbaren Energien, sondern
auf mangelnde Flexibilität des Stromsystems zurückzuführen" (140608).
Wie diese Studie weiter feststellte, hatten in den Zeiten negativer Strompreise
nur Gas- und Steinkohlekraftwerke ihre Stromproduktion weitgehend gedrosselt.
Die Kernkraftwerke blieben dagegen mit 65 Prozent und die Braunkohlekraftwerke
mit 50 bis 40 Prozent ihrer Leistung am Netz. Hinzu haben wärmegeführte KWK-Anlagen
zwangsläufig weiterhin Strom produziert. Im Ergebnis waren so immer 20 bis 25
Gigawatt konventioneller Kraftwerksleistung am Stromnetz. Die Ursachen dafür
lägen unter anderem in den An- und Abfahrkosten dieser Kraftwerke, den aktuellen
Regelungen für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen sowie dem Gebotsdesign
am Spotmarkt. Bei Negativpreisen zwischen null und zehn Euro/MWh könne aus betriebswirtschaftlicher
Sicht der Weiterbetrieb konventioneller Wärmekraftwerke sogar über einen längeren
Zeitraum lohnender als das Abfahren sein.
Bei konventionellen Kraftwerken gibt es einen hohen Sockel
an "preisunelastischer Erzeugungsleistung"
Infolge der Stilllegung sämtlicher Kernkraftwerke sowie etlicher Braunkohleblöcke
ist inzwischen das größte Hemmnis für eine weitere Erhöhung des Erneuerbaren-Anteils
entfallen. Im Jahresdurchschnitt kann der Grünstrom mehr als die Hälfte des
Stromverbrauchs decken. An verbrauchsschwächeren Tagen würde es mitunter schon
für den gesamten Bedarf reichen. Allerdings nur rechnerisch. Der alte Konflikt
zwischen den Erneuerbaren und dem konventionellem Kraftwerkspark ist nämlich
noch nicht ganz entschärft. Bis auf weiteres gibt es einen notwendigen Restbestand
an konventioneller Kraftwerkskapazität, auf den aus verschiedenerlei Gründen
vorerst nicht verzichtet werden kann und der auch dann bei Negativpreisen ins
Netz einspeist, wenn er zur Deckung der Residuallast gar nicht benötigt würde.
Meistens sind das mit Gas oder Kohle betriebene KWK-Anlagen, die als Wärmelieferanten
weiterlaufen müssen.
Dass Stromerzeuger ihre Anlagen auch bei Negativpreisen weiter ins Netz einspeisen
lassen, hat jedenfalls nichts mit Schlamperei oder mangelnden Rechenkenntnissen
zu tun. Vielmehr handelt es sich in der Regel um wohlkalkulierte Entscheidungen.
So hatten die Betreiber von Windkraft- und Solaranlagen lange Zeit gute Gründe,
ihre Anlagen auch bei mäßig negativen Preisen nicht abzuschalten, weil sonst
die "Marktprämie" entfallen wäre. Brennstoffkosten entstanden ihnen
durch den Weiterbetrieb sowieso nicht. Unrentabel wurde die Einspeisung deshalb
erst, wenn die Negativpreise die Einnahmen durch die EEG-Förderung überstiegen.
Ebenso gab und gibt es weiterhin einen Sockel an "preisunelastischer Erzeugungsleistung
von konventionellen Kraftwerken". In ihrem zuletzt erschienenen "Bericht zur
Mindesterzeugung 2021" veranschlagte die Bundesnetzagentur diesen Sockel mit
etwa 16 bis 18 Gigawatt, nachdem sie ihn im ersten Bericht für das Jahr 2015
noch bis auf 28 Gigawatt geschätzt hatte. Die zum Ausgleich der Residuallast
oder zur Bereitstellung von Regelenergie vorläufig noch notwendige "Mindesterzeugung"
machte dabei nur zwischen einem Viertel und einem Drittel der gesamten "preisunelastische
Erzeugungsleistung" aus.
"Insbesondere die Opportunitätskosten sind ein Geschäftsgeheimnis"
Man muss jedenfalls kein Mitleid mit den Stromerzeugern haben, wenn sie ihre
Ware nur gegen Zuzahlung loswerden, und es ist dadurch auch keine Gefährdung
der Stromversorgung befürchten, wie das in einer Anfrage anklang, die der AfD-Abgeordnete
Harald Weyel anläßlich des bereits erwähnten Negativpreis-Rekords vom 2. Juli
2023 an die Bundesregierung richtete. Für den damaligen Bundeswirtschaftsminister
Habeck antwortete dessen Staatssekretär Nimmermann folgendermaßen:
"Welche Mehrkosten für diejenigen Stromerzeuger am 2. Juli 2023,
die trotz der negativen Strompreise weiter produziert haben, durch das kurzfristige
Auftreten von negativen Strompreisen entstanden sind, ist schwer zu beziffern.
Wollte man etwa vereinfachend die gehandelte Strommenge mit dem negativen
Preis multiplizieren, so würde dies zu erheblichen Unschärfen führen, weil
dabei die unterschiedlichen Grenz- und Opportunitätskosten der jeweiligen
Stromerzeuger unberücksichtigt blieben. Diese unterscheiden sich beispielsweise
in Abhängigkeit von Brennstoff, Wirkungsgrad und Flexibilität erheblich. Insbesondere
die Opportunitätskosten einzelner Stromerzeugungsanlagen sind nicht öffentlich
zugänglich und ein Geschäftsgeheimnis."
Man würde demnach nur näherungsweise den Opportunitätskosten und anderen Geschäftsgeheimnissen
auf die Spur kommen, wenn man die negativen Preise der insgesamt 15 Stunden
an diesem Tag mit den jeweiligen Leistungswerten multipliziert. Mangels sonstiger
verfügbarer Informationen ist es aber die Rechnung wert: Für insgesamt 666 746
MWh ergeben sich dann 75 Millionen Euro, welche die Einspeiser dem Strom hinterherwerfen
mussten. Pro Megawattstunde sind das im Durchschnitt 112 Euro – ungefähr 34
Euro mehr, als im Juli 2023 die ganz normale Megawattstunde an der Epex Spot
im Durchschnitt gekostet hat.
Der Staatssekretär unterstrich in seiner Antwort außerdem, dass negative Preise
eine wichtige Funktion im Strommarkt hätten: "Sie signalisieren, dass
das Stromsystem trotz der starken Signale in dieser Zeit nicht flexibel reagiert
hat, weder auf der Nachfrageseite noch durch die verbleibenden Kraftwerke im
System. Sie setzen deshalb wichtige Anreize, in Flexibilisierung zu investieren."
In ähnlicher Weise verteidigt die Epex Spot die Negativpreise: "Negative
Preise sind ein Signal, ein Indikator für Marktteilnehmer. Wenn Erzeuger sich
dazu entscheiden, ihre Stromproduktion weiterlaufen zu lassen, haben sie errechnet,
dass dies die wirtschaftlich beste Lösung für sie ist. Andernfalls müssten sie
ihre Anlagen abschalten und wieder hochfahren – auch das kostet teilweise viel
Geld und Zeit; Erneuerbare müssen ihr Förderregime berücksichtigen. Wenn die
negativen Preise zu zahlreich werden, könnten sie die Wirtschaftlichkeit künftiger
Produktionsanlagen in Frage stellen, aber sie könnten genauso gut auch für Verbrauchseinheiten
oder Speicheranlagen sprechen."
Volkswirtschaftlich ist nicht alles sinnvoll, was betriebswirtschaftlich
vorteilhaft erscheint
Das stimmt zwar alles im großen und ganzen, darf aber nicht den Blick dafür
verstellen, dass es keineswegs ein Idealzustand ist, wenn es bei der Herstellung
des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage derart knirscht, dass große
Strommengen doppelte Kosten verursachen: Zuerst für ihre Herstellung und dann
für ihre Entsorgung zu Aufpreisen. Das mag zwar aus rein betriebswirtschaftlicher
Sicht sowohl für den Erzeuger als auch für dessen Abnehmer vorteilhaft sein.
Volkswirtschaftlich gesehen handelt es sich aber um Ballast, der über Opportunitätskosten
und andere Geschäftgeheimnisse das Strompreisniveau in undurchsichtiger Weise
zusätzlich belastet. Damit werden diese Kosten letztlich den Verbrauchern aufgebürdet.
Man müsste deshalb die Rahmenbedingungen zumindest so verändern, dass die negative
Preisskala zwar nicht abgeschafft wird – denn als Indikator ist sie in der Tat
nützlich – , aber möglichst nicht in Anspruch genommen werden muss.
"Solarspitzengesetz" ist ein Schritt in die richtige
Richtung
Ein Schritt in dieser Richtung ist das "Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts
zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen", das am 25. Februar
in Kraft trat und umgangssprachlich auch als "Solarspitzengesetz"
bezeichnet wird (siehe 250112). Es stoppt in §
51 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für neue Anlagen die Zahlung der EEG-Förderung
für jede Stunde, in der die Preise am Spotmarkt negativ sind. Ersatzweise wird
den Betreibern in § 51a nach Ablauf der zwanzigjährigen
Vergütungsdauer eine Verlängerung der Vergütung gewährt, die sich nach der Anzahl
der angefallenen Stunden mit Negativpreisen richtet. Eine ähnliche Regelung
greift ab 2027 auch für Bestandsanlagen. Da die EEG-Strommengen den größten
Teil der Erzeugung ausmachen, begründet das die Hoffnung, dass die Negativpreise
künftig zwar noch nicht verschwinden, aber doch weniger häufig auftreten und
weniger weit unter null liegen.
Geplante Gaskraftwerke verhindern eine wirklich zukunftsträchtige
Lösung
Damit die negativen Preise ganz verschwinden und der Ausgleich zwischen Angebot
und Nachfrage wie bei anderen Waren nur im positiven Bereich stattfindet, bedürfte
es aber weiterer gesetzlicher und auch technischer Änderungen. Vor allem müsste
endlich damit begonnen werden, die bei der Wind- und Solarstromerzeugung regelmäßig
anfallenden Überschüsse so zu speichern, dass "Dunkelflauten" und
"Hellbrisen" sich mit zeitlicher Verzögerung wechselseitig ergänzen
und dadurch aufheben können. Das setzt eine "Speicherung" des überschüssigen
Stroms mittels Energiewandlern wie Batterien, Pumpspeicherkraftwerken oder Elektrolyseuren
voraus.
Batteriespeicher haben inzwischen eine enorme Leistungsfähigkeit erreicht.
Sie eignen sich aber nur sehr bedingt für die längerfristige Speicherung großer
Energiemengen. Pumpspeicherkraftwerke sind eine seit über hundert Jahren erprobte
und weiterentwickelte Technik. Sie sind aber von topografischen und anderen
Voraussetzungen abhängig, die es kaum noch irgendwo in Deutschland gibt. Deshalb
wäre der vielversprechendste Weg die elektrolytische Umwandlung von Grünstrom-Überschüssen
zu Wasserstoff, der ähnlich wie Erdgas in unterirdischen Speichern gelagert
und bei Bedarf mittels Gaskraftwerken wieder in Strom umgewandelt wird – im
Unterschied zu Erdgas aber absolut klimaunschädlich wäre.
Stattdessen kündigte die amtierende Bundeswirtschaftsministerin Reiche jetzt
die Errichtung von bis zu zwanzig Gaskraftwerken an, die offenbar nur mit Erdgas
betrieben werden sollen. Sie verzichtet dabei sogar auf das Feigenblatt "H2-ready",
mit dem die Vorgänger-Regierung ihre diesbezüglichen Blößen gern verdeckte (250706).
Deren Pläne für die Schaffung eines "Kapazitätsmarkts", der auch die bloße Vorhaltung
von Kraftwerksleistung für netztechnische Zwecke honoriert, sahen nur halb soviel
Gaskraftwerke vor, die aber zumindest perspektivisch auf Wasserstoff umgestellt
werden sollten. Das hätte den Einstieg in das beschriebene Modell der kurz-
und langfristigen Netzregelung ermöglicht, das sowohl "Dunkelflauten"
als auch "Hellbrisen" entschärfen und eine Netzstabilität ermöglichen
könnte, bei der es weder zu Preisexplosionen noch zu Negativpreisen kommt. Unter
dieser Bundesregierung wird daraus nun aber wohl vorerst nichts.