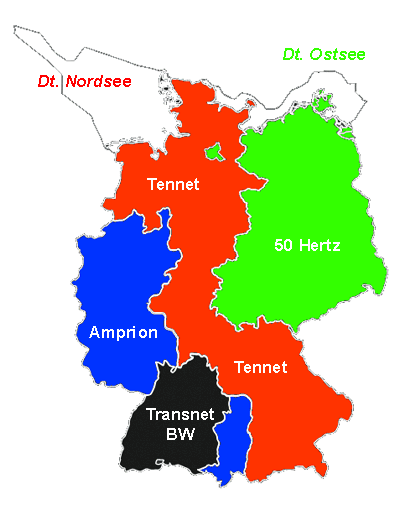 |
Nach Fläche und Stromkreislänge ist die TenneT TSO GmbH der größte der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber.
September 2025 |
250904 |
ENERGIE-CHRONIK |
Der staatliche niederländische Netzbetreiber TenneT hat 46 Prozent der Anteile am größten deutschen Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO, der ihm bisher zu hundert Prozent gehörte, an ein internationales Investorenkonsortium verkauft. Wie er am 24. September mitteilte, handelt es sich dabei um den norwegischen Staatsfonds Norges, den niederländischen Pensionsfonds APG und den singapurischen Staatsfonds GIC. Angeführt wird das Konsortium vom norwegischen Staatsfonds Norges, der künftig mit 21,8 Prozent an der TenneT TSO beteiligt sein wird. Der Verkauf der Anteile kommt im Wege einer Erhöhung des Eigenkapitals der Tennet TSO GmbH um bis zu 9,5 Milliarden Euro zustande. Die jetzt vereinbarte Transaktion soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vollzogen werden. Unter anderem bedarf sie noch der Zustimmung der Regulierungsbehörden.
|
|
Nach Fläche und Stromkreislänge ist die TenneT TSO GmbH der größte der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. |
Die Eigenkapitalerhöhung soll die chronischen Finanznöte der Tennet TSO lindern, die in einem über 140.000 Quadratkilometer großen Netzgebiet, das von den Alpen bis zur dänischen Grenze reicht, Höchstspannungsleitungen mit einer Stromkreislänge von mehr als 14.000 Kilometer betreibt und außerdem für die Netzanschlüsse der Windparks in der deutschen Nordsee zuständig ist. Die TenneT TSO ist damit deutlich größer als ihr niederländischer Eigentümer, der seine deutsche Tochter im November 2009 vom E.ON-Konzern zum Schnäppchenpreis von rund einer Milliarde Euro erwerben konnte (091101). Das an die Niederlande verkaufte Höchstspannungsnetz hatte der Konzern wenige Monate zuvor aus dem Besitzstand seiner Tochter E.ON Netz GmbH herausgelöst und in "Transpower" umbenannt (091005). Aus diesem Grund hat die TenneT TSO bis heute auch ihren Sitz in Bayreuth, wo die bis 2014 bestehende E.ON Netz GmbH angesiedelt war.
Weil die Mutter deutlich kleiner war als die Tochter, konnten oder wollten die Niederländer ihrer Neuerwerbung nicht ausreichend unter die Arme greifen, als diese sich bald mit der Verpflichtung zum Anschluss von neuen Offshore-Windparks in der Nordsee überfordert sah. Im November 2011 verschickte die deutsche TenneT TSO sogar Schreiben an das Bundeskanzleramt sowie die Ministerien für Wirtschaft und Umwelt, in denen sie eine Art Offenbarungseid leistete und erklärte, ihre Verpflichtungen als Netzbetreiber aus finanziellen Gründen nicht vollständig erfüllen zu können (111104). Die Bundesnetzagentur verweigerte ihr deshalb fast drei Jahre lang die gesetzlich vorgesehene Zertifizierung (121105 und Hintergrund).
Inzwischen sind die Kosten für den notwendigen Ausbau des Übertragungsnetzes infolge von Stromhandel und Energiewende noch viel höher geworden. Vor diesem Hintergrund teilte die niederländische TenneT am 10. Februar 2023 mit, dass sie den Verkauf ihrer Tochter an den deutschen Staat erwäge. Sie selber habe einen Kapitalbedarf von 10 Milliarden Euro, um ihre eigenen Aktivitäten finanzieren zu können, während der Kapitalbedarf ihrer deutschen Tochter auf 15 Milliarden Euro geschätzt werde. Es sei sicher die beste Lösung, wenn die Regierungen in Den Haag und Berlin ihre jeweiligen nationalen Stromnetze selber besitzen, kontrollieren und finanzieren würden. TenneT beabsichtige deshalb, Gespräche mit der deutschen Regierung über einen vollständigen Verkauf der deutschen Tochter "zu akzeptablen Bedingungen" aufzunehmen (230201).
In der Tat wäre es von Anfang an die beste Lösung gewesen, die vier Betreiber des deutschen Höchstspannungsnetzes zu einem einzigen staatlichen Netzbetreiber zu vereinigen, wie das in allen anderen Ländern der EU der Fall ist. Die Gelegenheit dazu hätte sich geboten, als die drei großen Stromkonzerne E.ON, Vattenfall und RWE in den Jahren 2009 bis 2011 diesen Bereich ihres Netzgeschäfts für insgesamt nur 2,6 Milliarden Euro verscherbelten. Grund für den Ausverkauf an der Resterampe waren die damals in Kraft tretenden Vorschriften zur Entflechtung der Geschäftsbereiche Erzeugung und Netz/Vertrieb sowie die damit einhergehende Regulierung des Netzbetriebs. Die Konzerne erwarteten deshalb im Sektor Höchstspannung nur noch vergleichsweise bescheidene Gewinne, die allenfalls für Pensionsfonds und ähnliche Anleger interessant waren, die besonderen Wert auf eine staatlich garantierte Rendite legten. Zugleich versprachen sie sich mehr davon, die mit dem Verkauf der Netze erzielten Erlöse in den Bau neuer Kraftwerke zu investieren. Lediglich die EnBW verzichtete damals auf den Verkauf ihres Transportnetzbetreibers TransnetBW (siehe Hintergrund, November 2023).
Da sich die EnBW ohnehin schon fast hundertprozentig im Besitz der öffentlichen Hand befand, hätte man so aus den vier Betreibern der Höchstspannungsnetze mit minimalem finanziellen Aufwand einen für das ganze Land zuständigen nationalen Übertragungsnetzbetreiber bilden können, wie es ihn in allen anderen EU-Staaten gibt. Stattdessen beließen es die seinerzeitigen Bundesregierungen (Merkel 1 und Merkel 2) bei den vier Übertragungsnetzbetreibern, die infolge der Liberalisierung des Strommarktes von einer ursprünglich mehr als doppelt so großen Anzahl an "Verbundnetzen" mit jeweils exklusiven Regel- und Versorgungsgebieten übrig geblieben waren (siehe Grafik). Die Politik begnügte sich damit, diese vier Netzbetreiber zu einer möglichst effizienten und kostensparenden Kooperation zu verpflichten (100301). Das deutsche Übertragungsnetz ist deshalb mit dieser Struktur ein antiquiertes Unikum in Europa.
Das Verkaufsangebot der TenneT, hinter dem die niederländische Regierung als Eigentümer stand, eröffnete der Bundesregierung die Chance, die vor mehr als einem Jahrzehnt begangenen Fehler wenigstens teilweise zu korrigieren. Mit dem kompletten Erwerb der deutschen TenneT-Tochter hätte sie den Besitzstand wesentlich erweitern können, über den sie bereits mit den Beteiligungen an 50 Hertz (180709) und TransnetBW (231108) verfügte. Allerdings war nun das von den Alpen bis zur Nordsee reichende Höchstspannungsnetz nicht mehr für die 1,1 Milliarden Euro zu haben, für die es einst TenneT von E.ON bekam. Schließlich war es inzwischen um gut dreitausend Kilometer länger geworden und hatte auch sonst viel Geld verschlungen, was samt den Garantie-Renditen für den niederländischen Eigentümer in die Netzentgelte einging und letztendlich von den Stromverbrauchern bezahlt wurde. Vor allem bestand der Kaufpreis zum größten Teil aus 16 Milliarden Euro Schulden, so dass sich der Nettoerlös für die Niederländer auf 4 Milliarden reduziert hätte.
|
|
Bis 1997 gab es in Deutschland neun Übertragungsnetzbetreiber und neun Regelzonen. In den folgenden fünf Jahren verringerte sich diese Zahl auf vier. Bis 2010 bekamen drei davon neue Namen. |
Trotzdem wären die zwanzig Milliarden Euro, die TenneT als Kaufpreis nannte, immer noch vergleichsweise günstig gewesen, falls die Bundesregierung zugegriffen hätte. Aktuell war die Ampel-Regierung in Berlin aber viel zu sehr mit ihrem koalitionsinternen Streit um die Haushaltsplanung beschäftigt, um die Verhandlungen über den Kauf der Tennet TSO fortsetzen zu können (die auf Wunsch der Bundesregierung schon vor eineinhalb Jahren begonnen hatten, wie der niederländische Finanzminister Steven van Weyenberg später wissen ließ). Einen Monat nach der offiziellen Bekanntgabe der Offerte veröffentlichte die TenneT deshalb am 15. Mai 2023 eine Pressemitteilung, wonach sie bereits auf der Suche nach alternativen Käufern sei. Damit sollte die Regierungskoalition unter Druck gesetzt und signalisiert werden, dass es auch andere Interessenten gäbe, falls die FDP dieses Geschäft weiterhin verhindern sollte. (240501)
Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner beharrte indessen auf seiner strikten Ablehnung des Kaufs, obwohl die 20 Milliarden den Bundeshaushalt nicht direkt belastet hätten, sondern nur mit den Finanzierungskosten. Der Erwerb sollte nämlich über die bundeseigene KfW-Bank abgewickelt werden, wie das schon bei 50Hertz und TransnetBW der Fall war. Aber auch die Finanzierungskosten wollte die FDP nicht akzeptieren, weshalb die Ende 2022 begonnenen Verhandlungen endgültig scheiterten.
Inzwischen ist die Ampel-Koalition vorzeitig zerbrochen und die FDP, die daran hauptsächlich schuld war, zum zweiten Mal in der wohlverdienten parlamentarischen Versenkung verschwunden (siehe Hintergrund, November 2024). Die neue Bundesregierung aus Union und SPD wäre durchaus geneigt, die Verhandlungen über eine Beteiligung an der TenneT TSO wieder aufzunehmen. Das machte sie schon im Koalitionsvertrag deutlich, in dem es auf Seite 35 heißt: "Wir prüfen strategische staatliche Beteiligungen im Energiesektor, auch bei Netzbetreibern." Die niederländische Regierung ist ebenfalls weiterhin an einem deutschen Einstieg bei TenneT TSO interessiert. Am 18. September teilte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen mit, dass die deutsche Regierung erneut Interesse an einer Minderheitsbeteiligung bekundet habe und dass er dies befürworte.
Allerdings wird diese Minderheitsbeteiligung dann deutlich teuerer werden als dem Preis entspräche, über den bis zur Sabotierung der Gespräche durch die FDP verhandelt wurde. Das liegt daran, dass bei dem nunmehr vereinbarten Einstieg des internationalen Finanzkonsortiums "ein Unternehmenswert von rund 40 Milliarden Euro auf Cash- und schuldenfreier Basis" zugrunde gelegt wurde. Das ist doppelt soviel wie die rund 20 Milliarden Euro, zu dem die Ampel-Regierung sämtliche Anteile an TenneT TSO bekommen hätte, wenn SPD und Grüne einen vernünftigeren Koalitionspartner als die FDP gehabt hätten.